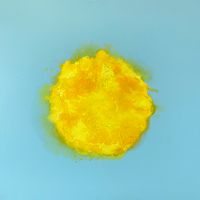Tobias Wyrzykowskis Bilder wirken entrückt und reduziert. Der Betrachter schaut aus der Distanz auf das Geschehen. Wiederkehrende Motive sind die vier Elemente, hinzu kommen Sterne und Kometen, Küsten und Horizonte, Schnee und Eis, Berge, Wiesen. Spuren von Menschen gibt es nur wenige: mal ein Schiff, eine Brücke, eine Rakete, ein Haus oder eine Pyramide. Wyrzykowski spricht von nicht greifbaren Bildwelten, die nicht beliebig, sondern - wie Traumbilder - mehrdeutig sind. In der Mythologie wird die Unterwelt dreigeteilt. Die Insel der Seligen, die Hölle, und im Zwischenraum auf mythischen Gefilden wachsen Asphodelen auf Asphodeloswiesen. Die Ostwand des Mount Everest – oder Kangshung-Direttissima – ist bisher noch unbestiegen. Würde man dies tun, müsste man eine der größten Hürden der Erde durchklettern. Eine weit mehr als 3.500 Meter hohe, steile Felswand. Die Malereien entstehen intuitiv, je nach Stimmung, teils gedankenverloren, oder tatsächlich nach Traumresten.